Es sieht so aus, als ob wir nicht das finden konnten, wonach du gesucht hast. Möglicherweise hilft eine Suche.
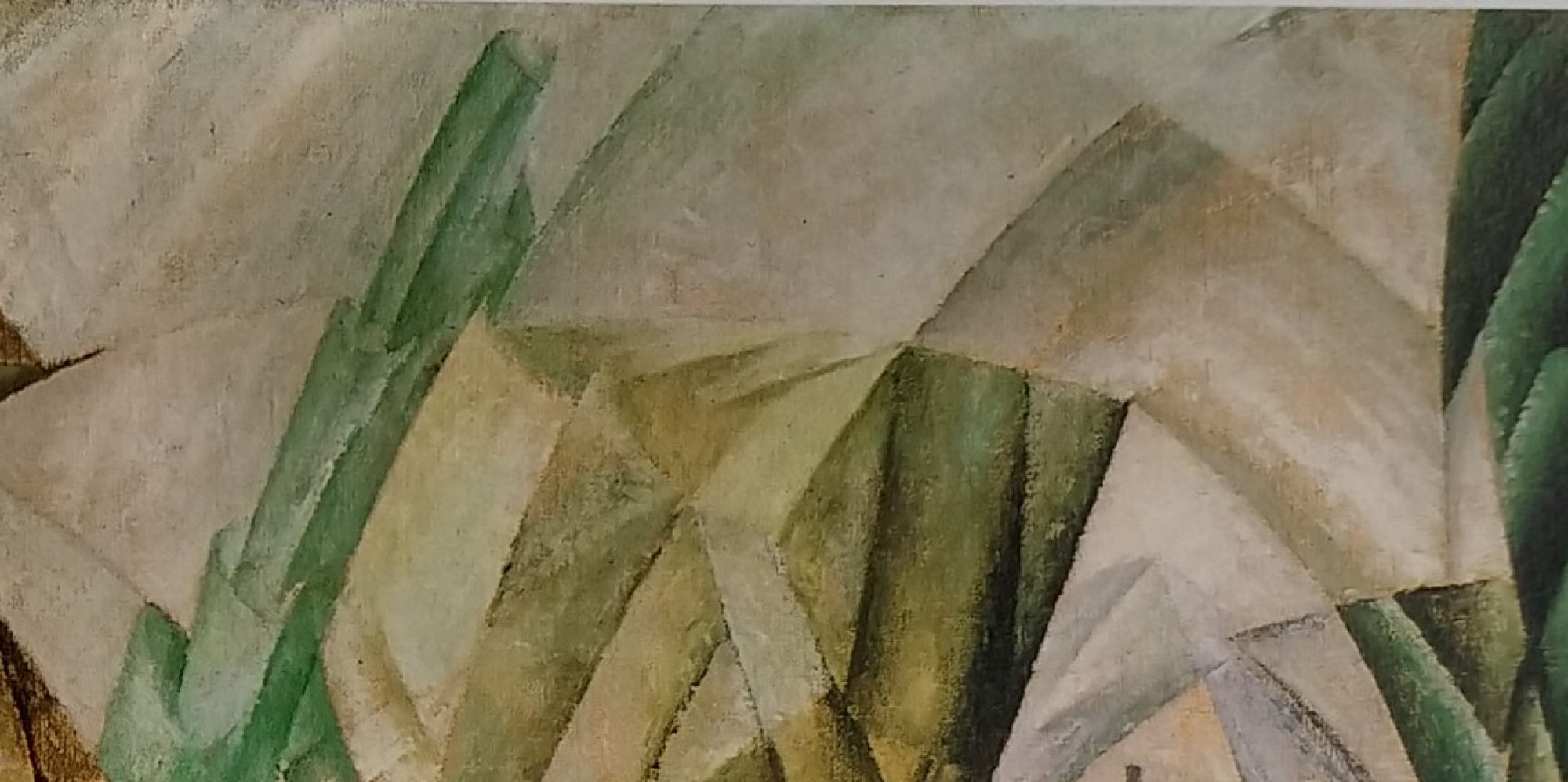
Corona und Psychologie
Angst Isolation Unsicherheit Kontrolle: Hilfe und Erklärungen
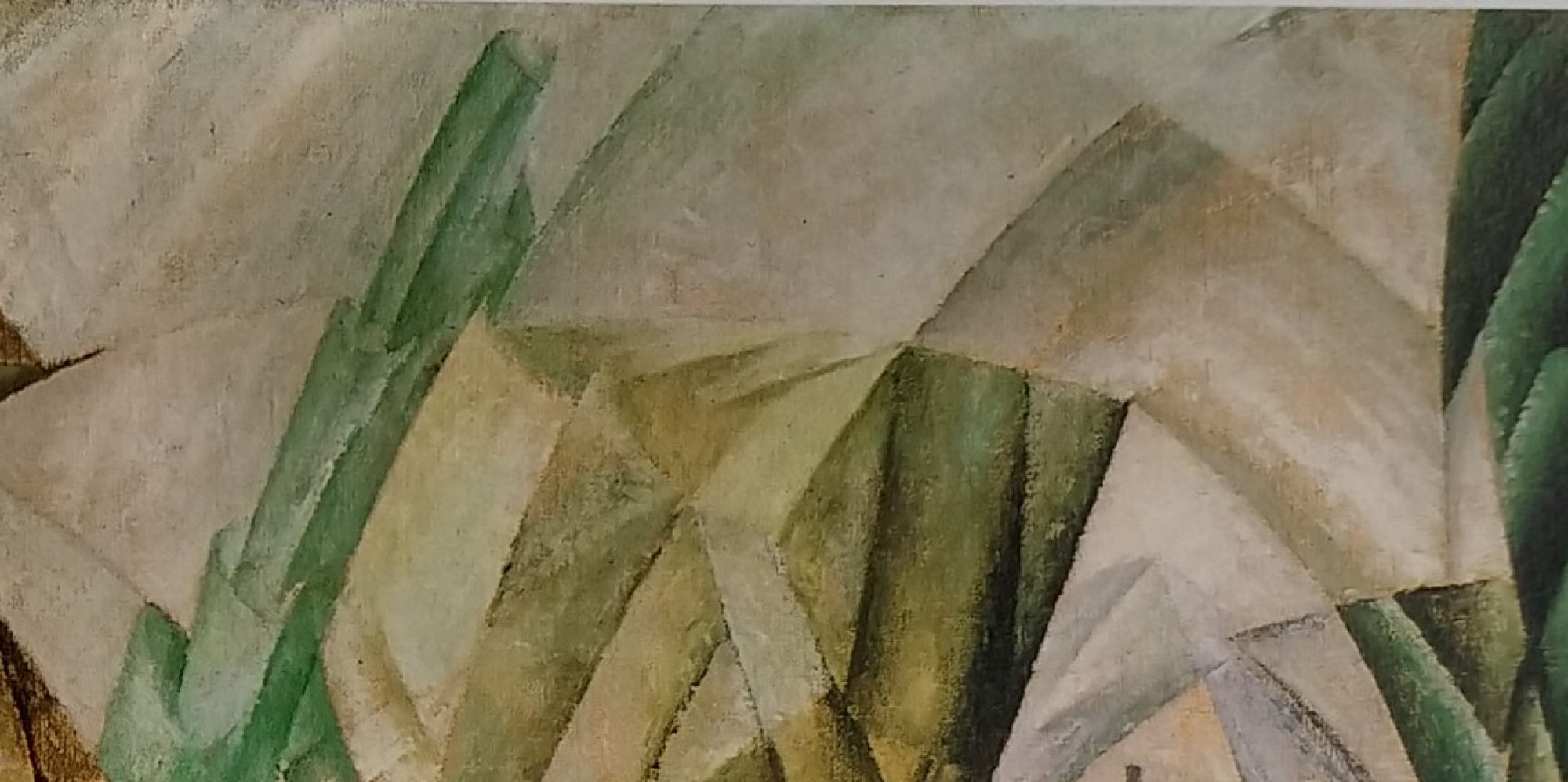
Angst Isolation Unsicherheit Kontrolle: Hilfe und Erklärungen
Es sieht so aus, als ob wir nicht das finden konnten, wonach du gesucht hast. Möglicherweise hilft eine Suche.